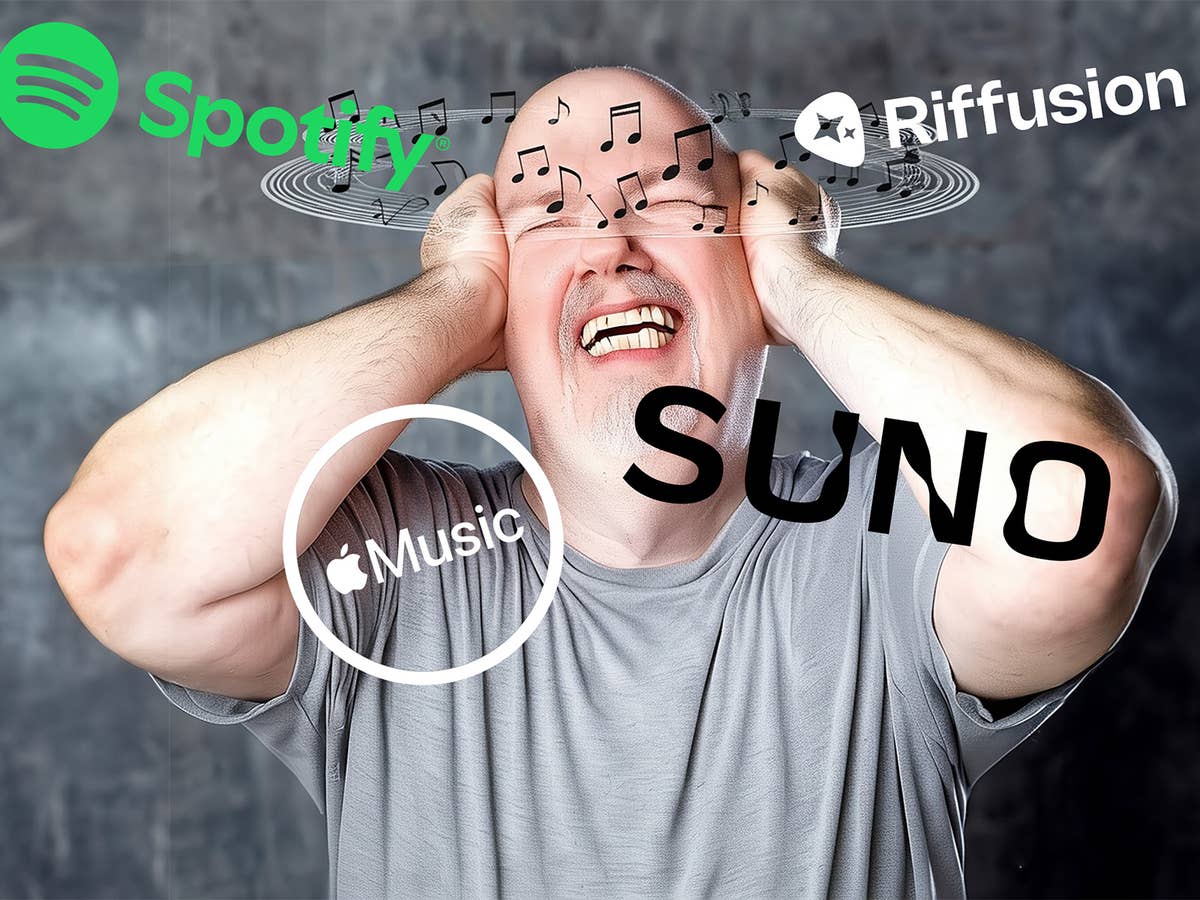Ach, Musik – was wär ich nur ohne dich? Irgendwann so um 1978 herum hat der siebenjährige Casi, mit sauberem Seitenscheitel und neugierigem Blick, rausgefunden, dass der Kassettenrekorder im Wohnzimmer nicht nur abspielen, sondern auch Radio empfangen konnte. Sehr verrauscht konnte man RTL hören, und so öffnete sich ein magisches Portal in eine wunderbare musikalische Welt.
Ab da war das Radio mein ständiger Begleiter. Ich entdeckte die Klassiker: Beatles, Elvis – und dann, 1982, kam Depeche Mode. Erst verliebt in ihre Musik, dann – vier Jahre später – dank ihrer Musik zum ersten Mal auch in ein Mädchen. Depeche Mode wurden zum Soundtrack meines Lebens. Und überhaupt war Musik immer mein Motor, mein Kompass, mein Rettungsring – bis heute.
Wir springen ins Jahr 2025: Heute reichen ein paar Worte – ein Prompt – und zack, ist ein kompletter Song generiert. Letzten Sommer hat es so ein KI-Song bis auf Platz 48 der deutschen Charts geschafft. Schon ein Jahr vorher ging ein Track viral, der klang, als hätten Drake und The Weeknd gemeinsame Sache gemacht – aber auch hier waren die Stimmen einfach nur täuschend ähnliche KI-Varianten.
Wir leben also in einer Zeit, in der man Stimmen und Instrumente aus dem digitalen Nichts erschaffen kann. Okay, „aus dem Nichts“ ist natürlich Quatsch, denn mit irgendwas wurde die künstliche Intelligenz ja schließlich trainiert. Das soll aber heute nicht das Thema sein.
Das Problem mit KI-Musik
Auf den ersten Blick wirkt KI-Musik ganz harmlos: Sie klingt okay, manchmal sogar überraschend witzig, dudelt unauffällig vor sich hin und passt perfekt in jede Algorithmus-Playlist. Und genau da liegt das eigentliche Problem. Oder besser gesagt, die Probleme, denn ich hab derer sechs ausgemacht:
1. Austauschbarkeit statt Originalität
Was KI da produziert, basiert auf dem, was schon da ist – auf Mustern, die bekannt und bewährt sind. Das Ergebnis: Songs, die gut reinlaufen, aber selten wirklich was wagen. Gefälliger Sound ohne Ecken und Kanten. Hauptsache, es funktioniert.
2. Keine echte Emotion
KI kann Emotionen simulieren – aber eben nicht fühlen. Und genau das spürt man. Vielleicht nicht immer bewusst, aber irgendwas fehlt. Diese kleine Unschärfe, dieses Persönliche, das einen Song auflädt. Echte Musik lebt, KI-Musik läuft.
3. Verdrängung echter Künstler:innen
Weil KI-Songs billig und skalierbar sind, überfluten Plattformen wie Spotify ihre Systeme damit. Für echte Musiker:innen wird’s eng beim Kampf um Aufmerksamkeit, um Einkommen, ums bloße Dasein. Wer nicht auftaucht, findet nicht statt.
4. Ist Musik überhaupt noch was wert?
Was man in Sekunden erschaffen kann, verliert an Gewicht. Wenn jede Idee auf Knopfdruck generierbar ist, was ist dann noch besonders? Die Geschichte hinter einem Song, der kreative Schmerz, der Stolz – plötzlich alles verzichtbar.
5. Der Algorithmus beherrscht uns
KI-Songs sind gebaut fürs Streamen: schneller Einstieg, catchy Hook, kaum Skip-Potenzial. Sie füttern ein System, das längst mehr auf Funktion als auf Kunst setzt. Was hängen bleibt, ist das, was am wenigsten stört.
6. Rechtliche und ethische Grauzonen
Was passiert, wenn eine KI klingt wie Taylor Swift oder ein Beat exakt wie der von Timbaland? Wem gehört das? Wer haftet, wenn’s zu nah dran ist? Das Gesetz kommt kaum hinterher – und ethische Leitplanken fehlen vielerorts völlig.
Wir sind selbst schuld an der Misere!
Klar, wir sind doch bloß die Konsument:innen am Ende der Nahrungskette, oder? Die kleinen Leute, die hören, was ihnen vorgesetzt wird. Mag stimmen – aber trotzdem haben wir alle gemeinsam diesen Weg mitgestaltet. Zusammen mit der Musikindustrie, den Artists und allen anderen, die irgendwie Teil des Systems sind.
Eine kleine Historie des Musikkonsums
Vielleicht fing’s schon mit der CD an. Praktischer als Vinyl, kein Knistern, kein Springen. Videotheken hatten plötzlich CD-Regale, aus denen man sich für wenig Geld die Top-Hits holen konnte – um sie dann auf Kassette zu überspielen. Später brannten wir uns die Alben einfach direkt. Und währenddessen machte das MP3-Format das Netz unsicher. Plötzlich bastelten wir unsere eigenen Compilations – digitale Mixtapes für jede Stimmung.
Dann kamen Napster, LimeWire & Co., und auf einmal war Musik für viele kostenlos. Gigabyteweise luden wir ganze Diskografien runter – nicht ganz legal, aber trotzdem mit erstaunlich gutem Gewissen. Über kostenpflichtige Downloads bei iTunes, Amazon oder Google ging’s dann weiter zum Streaming. Und schwups, landeten wir bei Spotify & Co.
Der Algorithmus ist der Endboss
Und jetzt? Eigentlich müsste der kleine Casi von damals ausflippen vor Freude. Wo ich mir damals nur eine Maxi-Single oder ein Album im Monat leisten konnte, avancierte ich nun zum vielfachen Song-Millionär. Ich liebe immer noch meine Playlists (wie meine fast fünf Tage lange 80s-Playlist), hab meine alten Lieblingsplatten gespeichert und freue mich trotzdem über jeden neuen Fund.
Dieses Element kann auf dieser reduzierten Version der Webseite nicht dargestellt werden.
jetzt ansehenGanz unauffällig haben sich unsere Hörgewohnheiten verändert. Schon mit den ersten MP3s verlor das klassische Album an Bedeutung – wir wollten lieber unsere eigenen Compilations. Und spätestens mit Spotify hatte der Algorithmus das Steuer übernommen. Er wusste ziemlich schnell, was ich mag – und lieferte passende Vorschläge. Klingt erst mal super.
Aber der Algorithmus wollte auch gefüttert werden – und zwar nicht nur von mir, sondern auch von den Künstler:innen. Wer in den relevanten Playlists landen will, darf nicht zu sehr aus der Reihe tanzen. Und weil mit Musik kaum noch Geld verdient wird, mussten sich viele fügen: Spotify zahlt Centbeträge, also zählt jeder Stream. Und gezählt wird er erst, wenn du mindestens 30 Sekunden dranbleibst.
Was passiert also? Songs starten heute nicht mehr langsam. Kein langes Intro, kein Spannungsaufbau – stattdessen direkt Vollgas. Hook, Melodie, Beat: alles in den ersten Sekunden. Außerdem werden Songs kürzer. Ein Album mit 20 Mini-Tracks bringt einfach mehr Streams als eins mit sechs Longtracks. Es geht nicht mehr um Tiefe, sondern um Masse.
Was das jetzt alles mit KI-Musik zu tun hat? Ach sorry, ich dachte, das wäre dir klar geworden. Wir haben uns von der Haptik und dem Artwork des Vinylalbums verabschiedet, von der Klangqualität der CD, von der Albumstruktur und von der Originalität einzelner Songperlen. Geblieben ist Musik, die gemeinsam Hand in Hand ums goldene Kalb „Algorithmus“ herumtanzt. Sie wird so glatt geschliffen, dass der Algorithmus sie liebt. Musik wird so auf eine Formel reduziert. Der Song ist kurz, klingt bekannt, bricht aus keinem Muster aus, kann schön leicht wegkonsumiert werden, ohne dass sich jemand daran stört.
Und wer mag schön einfache Formeln (jenseits von einem der reichsten Europäer, Daniel Ek, der es als Spotify-Boss zu 8,2 Milliarden US-Dollar brachte)? Haargenau: KI! Je deutlicher KI einen Stuhl erkennen kann, desto besser kann sie im Bild einen Stuhl reproduzieren. Je deutlicher eine Reimform erkennbar ist, desto besser wird das von KI gefertigte Gedicht.
… und je klarer und deutlicher die Formel für einen bekömmlichen, auf Streaming optimierten Popsong ausgestaltet ist, desto besser liefert dir KI einen – na ja – bekömmlichen, auf Streaming optimierten Popsong. Aus Bequemlichkeit und besoffen von der Auswahl verfügbarer Songs haben wir zugelassen, dass unsere Charts von austauschbarer Ware durchflutet wurde, die wir nicht lieben, sondern konsumieren.
Musik ist für viele ein Geräusch geworden, das nebenher läuft, wenn wir am Handy daddeln, den Hausputz erledigen, Quatsch reden oder uns lieben. Unsere Kinder werden vielleicht keine Stars mehr anhimmeln – weil sie ihr eigener Star sind, der sich seine Musik selbst erstellt. Wir haben die kreative Fallhöhe von Charts-Musik so lange beschnitten, dass sie heute perfekt auf Höhe des Teppichs im Musikzimmer abschließt.
Und wenn unsere „Stars“ Musik auf den Markt werfen, deren Melodien wir schon Sekunden nach dem Fade out vergessen haben, und wir sie trotzdem weiter konsumieren – dann haben wir jeden Anspruch verspielt, uns über künstlich generierte Musik zu echauffieren.
Epilog:
Was wie ein Abgesang auf Musik klingt, ist natürlich nur ein möglicher Blickwinkel und natürlich auch schrecklich verallgemeinert. Selbstverständlich gibt es immer noch kreative Künstler:innen (wie beispielsweise Ren, checkt dringend mal seinen Kanal aus!). Und es wird immer Bühnen geben, vor denen sich Menschen versammeln, die vor den Augen echter Musiker:innen feiern, singen, springen und schwitzen wollen. Aber es ist trotzdem traurige Gewissheit: KI-Musik ist gekommen, um zu bleiben – und wir haben ihr selbst die Tür geöffnet und sie freundlich hereingebeten.